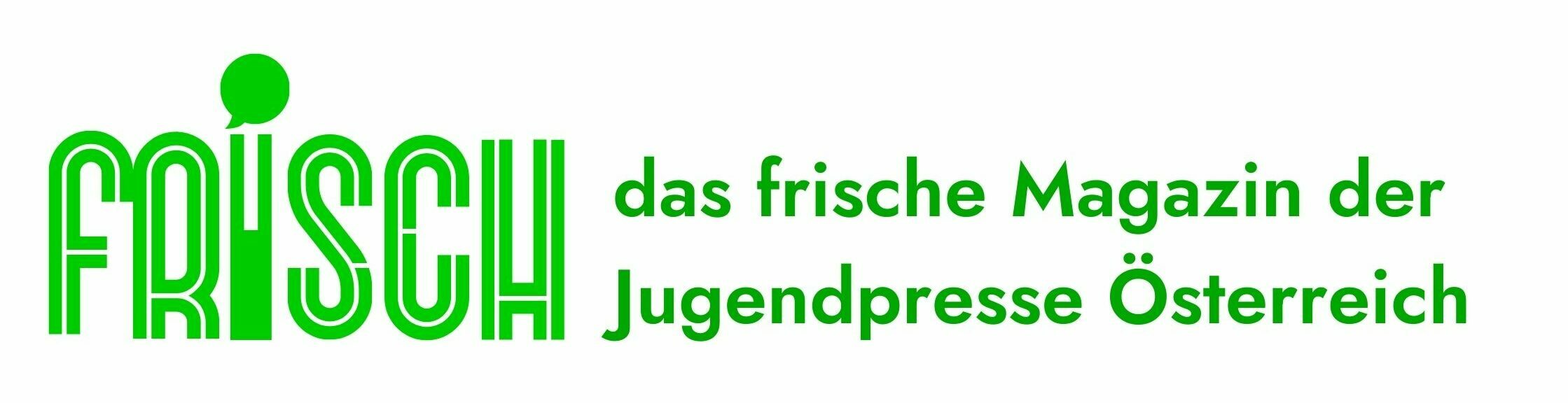Vom „anderen Ende der Welt“ kam der Argentinier Jorge Mario Bergoglio als er im März 2013 in Rom zum Papst gewählt wurde. Am Ostermontag um 7:35 verstarb Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren im Vatikan. Noch zuvor, am Ostersonntag, zeigte er sich – sichtlich angeschlagen – bei den Osterfeierlichkeiten auf der Benediktionsloggia des Petersdomes und bei einer Fahrt über den Petersplatz.
Die Amtszeit von Franziskus war davon geprägt, Menschen anzusprechen, ihnen entgegenzugehen und ihnen mit einfacher aber präziser Sprache zu begegnen. Franziskus agierte volksnah, aß mit den einfachsten Leuten und wohnte nicht in den Prunkgemächern des Vatikans, sondern im Gästetrakt Santa Marta und unterstrich hiermit, wie in seinen Parabeln und seiner bilderreichen Sprache, das armutsbetonte Leben. Franziskus schockierte wohl oft so manchen Mitarbeiter des päpstlichen Haushaltes mit dieser Volksnähe, so ging der Pontifex persönlich zu einem Optiker in Rom nahe des Petersdoms, um eine neue Brille zu kaufen – abgesehen von den sicherheitstechnischen Komplikationen, gab es bisher wohl wenige Päpste die selbst einkaufen gingen.
Sein Handeln war für viele Bewohnerinnen und Bewohner der „Westlichen Welt“ oft nicht verständlich, von vielen als für zu links, von anderen als zu rechts bezeichnet, musste Franziskus eine gigantische Institution leiten. Eine Institution, die seit 2000 Jahren besteht und die 1,39 Milliarden Mitglieder zählt; es hier allen recht zu machen, ist unmöglich. Als Oberhaupt der Katholischen Kirche war Franziskus Anführer einer Glaubensgemeinschaft, die aus den unterschiedlichsten Weltteilen besteht, hier zu einem Kompromiss zu kommen, ist eine schwere Aufgabe; hierin vereint sind „moderne“ und „unmoderne“, liberale und konservative Länder, Länder in denen das Christentum die Mehrheit stellt und Länder in denen die christlich Glaubenden nur einen kleinen Prozentsatz ausmachen. Sich zu echauffieren, dass der Papst nicht von heute auf morgen die Forderungen und Probleme der „Westlichen Welt“ rund um Zölibat, Frauenpriestertum und Handhabe mit gleichgeschlechtlichen Paaren so erfüllt wie es manche gerne hätten, ist unrealistisch und übersieht, dass die Katholische Kirche nicht nur in Europa agiert; besonders große Teile der Glaubensgemeinschaft leben außerhalb des Kontinents, den man vom Petersdom aus sieht.
Eine neue Herangehensweise aus der „Peripherie“
Franziskus hat sich diesen drängenden Fragen aber sehr wohl angenommen, während das Diakonat und Priesteramt für Frauen weiterhin umstritten diskutiert bleibt, stärkte der Pontifex Frauen innerhalb des vatikanischen Staatsapparates. Franziskus, der immer mit einer ruhigen und leisen Stimme sprach, war nicht nur Kirchen- sondern auch Staatsoberhaupt. Der Vatikan ist ein eigener Staat und der Papst ist, neben seiner Rolle als höchster Priester, auch ein wichtiger Politiker. Diese Verbindung von Religion und Diplomatie unterstrich Franziskus immer wieder mit seinen Reisen, die ihn nicht in die reichen und stabilen Regionen des christlichen Glaubens brachten, sondern an die „Peripherie“, so als er sich im Irak an die verfolgten, vertriebenen und ermordeten Christen erinnerte und einen Besuch in Israel und Palästina mit einem Rabbiner und einem Imam beging. Den ersten Besuch nach seiner Wahl im März 2013 machte Franziskus nicht etwa in sein Heimatland oder ein Land in dem ganz besonders viele Katholikinnen und Katholiken leben, er reiste in ein Flüchtlingslager auf Lampedusa, traf Flüchtlinge und gedachte denen, die auf der Überfahrt im Mittelmeer umkamen.
Der Papst fiel auch immer wieder durch seine Haltung zur Umwelt und eben der Migration auf. Er forderte in seinen Schriften einen gerechten Umgang mit der Natur und ein menschliches Begegnen mit Migranten. Den Kapitalismus prangerte er oft an und war bestrebt, die in undurchsichtige Korruption gehüllte Vatikanische Bank zu säubern, was mehr oder weniger gelang. Auch dem sehr prominenten Thema des Missbrauchs nahm sich Franziskus an, indem er eine strenge Politik der Absetzung und Strafe für Täter einläutete sowie eine Missbrauchskonferenz in Rom startete. Für wichtig erachtete der Papst zudem den interreligiösen Dialog, er tat bedeutende Schritte, indem er den Kontakt zu hohen muslimischen Vertretern suchte und mit ihnen wichtige Abkommen schloss. Kritik erfuhr Franziskus – ob zurecht oder nicht ist schwer zu richten – wegen seiner Handhabe als Bischof während der argentinischen Militärdiktatur.
Franziskus Erklärung, Segnungen von geschiedenen, wiederverheirateten und gleichgeschlechtlichen Paaren möglich zu machen, wurde von allen Seiten kritisiert. Die Einen nahmen an der Segnung selbst Anstoß und meinten so etwas würde zu weit gehen; die Anderen kritisierten, dass nur die Menschen selbst und nicht ihre Verbindungen gesegnet werden und meinten so etwas würde nicht weit genug gehen.
Franziskus verkörperte und symbolisierte Armut, sein gewählter Name nahm Bezug auf den Bettelheiligen Franziskus von Assisi; der Papst „fuhr“ ein kleines Auto und trug eine billige Uhr sowie schlichte schwarze Schuhe – im Vergleich zum pompösen Rot seiner Vorgänger. Dieser Armutsbezug und diese neue Art der Regierung stammen von Franziskus Herkunft, er gehörte dem jesuitischen Orden an und brachte eine südamerikanische, dem Menschen offene Lebensweise in den Kirchenstaat ein.
Papst Franziskus hatte immer wieder während seines Pontifikats mit seiner Gesundheit zu kämpfen, zuletzt erkrankte er im Frühjahr 2025 besonders schwer an einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung. Nach der Entlassung aus dem Spital wurde ihm eine Rekonvaleszenz aufgetragen, an die sich der Papst aber nicht hielt. Er lebte von der Interaktion mit Menschen, schon in seiner Heimatdiözese in Buenos Aires war ihm der Kontakt mit den Gläubigen und die gemeinsame Busfahrt mit ihnen wichtiger als das Wohnen im erzbischöflichen Palais. So nahm Franziskus – sichtlich geschwächt – an der Ostermesse im Vatikan Teil und sprach mit heiserer und angestrengter Stimme den Ostergruß, sowie die österliche Segensformel „urbi et orbi“ für die Gläubigen in Rom und dem Rest der Welt. Er ließ es sich danach nicht nehmen, die versammelten Gäste am Petersplatz zu begrüßen und schuf damit die letzten öffentlichen Bilder seines Pontifikats.
Franziskus letzte Worte auf dem Petersplatz gleichen seinen ersten auf diesem geschichtsträchtigen Platz: Kurz nach der Wahl 2013 begrüßte er die Pilgerinnen und Pilger am Platz mit „Fratelli e sorelle, buonasera!“. Im Zuge der diesjährigen Osterfeierlichkeiten wandte er sich mit seinen letzten öffentlichen Worten an die Zehntausenden: „Fratelli e sorelle, buona Pasqua!“ Während so Einige die Poesie eines Papsttodes zu Ostern hervorhoben, betonte der emeritierte österreichische Kardinal Christoph Schönborn das Vermächtnis von Papst Franziskus, das er ganz stark mit dem geflügelten Wort „Todos, todos, todos“ des Kirchenoberhauptes verbindet. Franziskus, so Schönborn, widmete sich Allen (todos) während seiner Amtszeit; auch und vor allem den Verfolgten, den Ausgestoßenen, den Armen.
Ein neues Konklave
Gedacht wurde dem verstorbenen Papst in Österreich um 17:00 mit dem Läuten aller Kirchenglocken des Landes für zehn Minuten. Um 18:00 wurde dem Heiligen Vater ein Gedenkgottesdienst im Wiener Stephansdom mit Kardinal Christoph Schönborn gehalten.
Die nächsten Tage werden das strikte Protokoll des Heiligen Stuhles zeigen, die Aufbahrung und das Begräbnis verstorbener Kirchenfürsten muss innerhalb weniger Tage nach dem Tod geschehen. Danach wird ein Konklave einberufen werden, zu dem eine große Menge der, auf der Welt verteilten, Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle zusammenkommen, um einen neuen Pontifex und den zukünftigen Weg der Katholischen Kirche zu wählen.